Noch vor einer Woche saß ich selbst in der Synagoge am jüdischen Neujahr und habe gebetet. Leise, nur für mich, niemanden störend. Kurz vorher haben wir Zuhause Apfel mit Honig gegessen und uns gegenseitig „Süßes neues Jahr“ gewünscht.
Heute, zehn Tage später, ist der höchste jüdische Feiertag – Jom Kippur, der Versöhnungstag. Versöhnen miteinander und mit Gott. Wir vertragen uns in diesen Tagen der Reue und Buße zwischen dem Neujahr und Jom Kippur, gehen in uns und überlegen, wem wir im letzten Jahr geschadet, wen wir beleidigt haben. Wir entschuldigen uns und reichen einander die Hand. Wir beten zusammen oder jeder für sich, privat. Manchmal singen wir zusammen, manchmal bewegen wir nur unsere Lippen, manchmal beten wir nur für sich- nicht hörbar. Wir sitzen Zuhause oder in der Gemeinde und begehen unsere Traditionen. Wir verletzen niemanden damit.
Wir beten am Jom Kippur dafür, in das Buch des Lebens eingetragen zu werden.
Leben, das heute zweimal ausgelöscht wurde- einfach so, für nichts. Ich möchte mich nicht versöhnen, nicht damit, dass irgendwelche Idioten über Tod und Leben urteilen. Dass es irgendjemanden stört, wenn ich friedlich in der Synagoge sitze und „nur“ bete, Gespräche mit dem lieben Gott und mit meiner Mama führe und fühle, in einer einmaligen Atmosphäre, die mir das Gefühl gibt, Teil einer starken Gemeinschaft und nicht alleine zu sein. Eine Gemeinschaft, die mich auch in der dunkelsten Dunkelheit meines Lebens getragen hatte. Ich möchte mir nicht das Gemetzel vorstellen, das entstanden wäre, hätten die Sicherheitsvorkehrungen der Haller Synagoge nicht standgehalten. An einem Ort, an dem ich mich immer sicher, behütet gefüllt habe. Nicht zuletzt wegen eines Polizeiautos davor, das in Halle an diesem Tag fehlte. Bis heute.
Meine Mama, die viel zu früh und viel zu unerwartet diese Welt verlassen musste, fand ihre letzte Ruhe auf einem jüdischen Friedhof. Dass sich jemand gewaltsam den Zutritt zu diesem Ort verschaffen und dort um sich schießen möchte, lässt mich erstarren. Weil jemand meinen Glauben, den ich tief in mir trage und ihn niemandem aufzwinge, dermaßen unerträglich findet.
Ich möchte keine Angst haben, ich möchte meine Religion nicht verheimlichen. Nicht aufpassen, wem ich von meinem jüdischen Namen, meiner Zeit an der jüdischen Grundschule, meinem jüdischen Ich erzähle. Und doch ist sie da: die Angst. Am falschen, aber eigentlich richtigem Ort, zur falschen, aber eigentlich richtigen Zeit, zu sein. Nicht mehr nach Hause zu kommen, nie wieder Äpfel in Honig tunken zu können. Ich war immer eine selbstbewusste Jüdin, mit einem jüdischen Symbol an meiner Kette, im Austausch mit anderen Menschen, Traditionen, Religionen. Immer in friedlicher Absicht. Immer in der Absicht zu vermitteln, dass in erster Linie der Mensch zählt und nicht sein Glaube.
Lea Feynberg
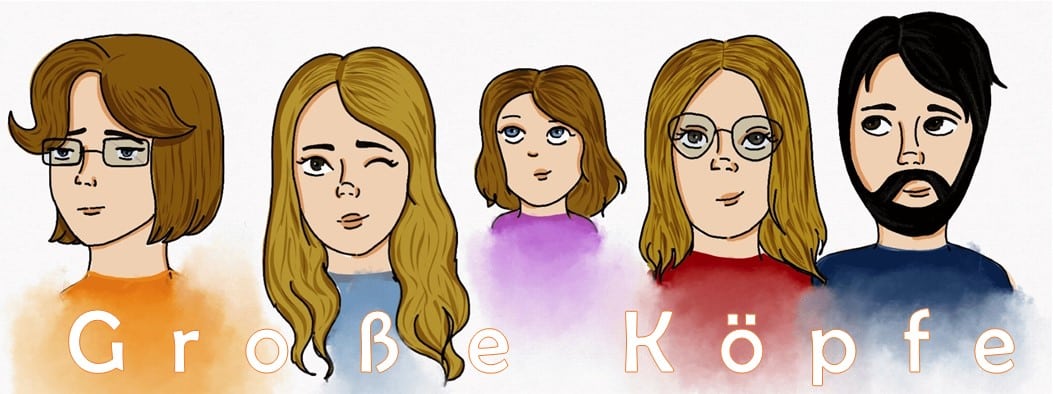



3 Comments
Sabine
10. Oktober 2019 at 21:52Danke fürs Schreiben! Es ist erschütternd, dass jüdisches Leben in Deutschland noch immer – und jetzt erst recht – mit Angst verbunden ist.
Denise BloggerMum
13. Oktober 2019 at 15:05Danke für den Text. Mir fehlen die passenden Worte. Es macht mich wütend, es macht mich traurig, dass Antisemitismus ein Thema sein muss. Wieder. Immer noch. Dieser Hass gegen Menschen. Wo bleibt der Respekt? Es darf nicht sein, dass Synagogen und jüdisches Leben mit Polizei geschützt werden müssen. Es sollte selbstverständlich sein, dass jeder seine Religion ausüben darf. Ich begreife weder emotional noch rational den Hass gegenüber Juden.
Monika
27. November 2019 at 13:46Es tut mir persönlich sehr viel leid was in Halle passiert ist. In einer demokratischen und offenen Gesellschaft soll niemand sich fürchten, seine Identität zu veröffentlichen. Vielen Dank für den Beitrag. Du bist die einzige, die zu solchen Themen schreibt.